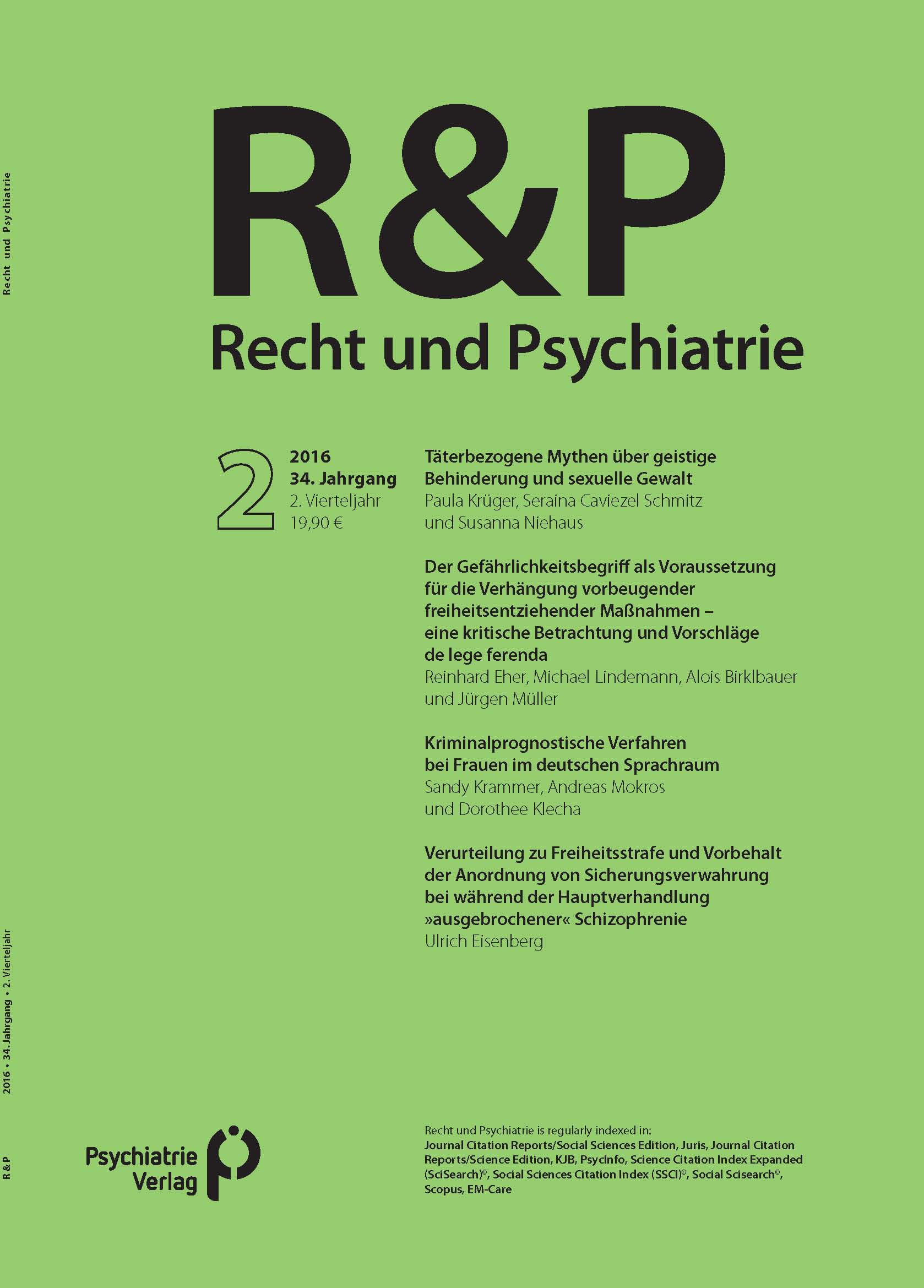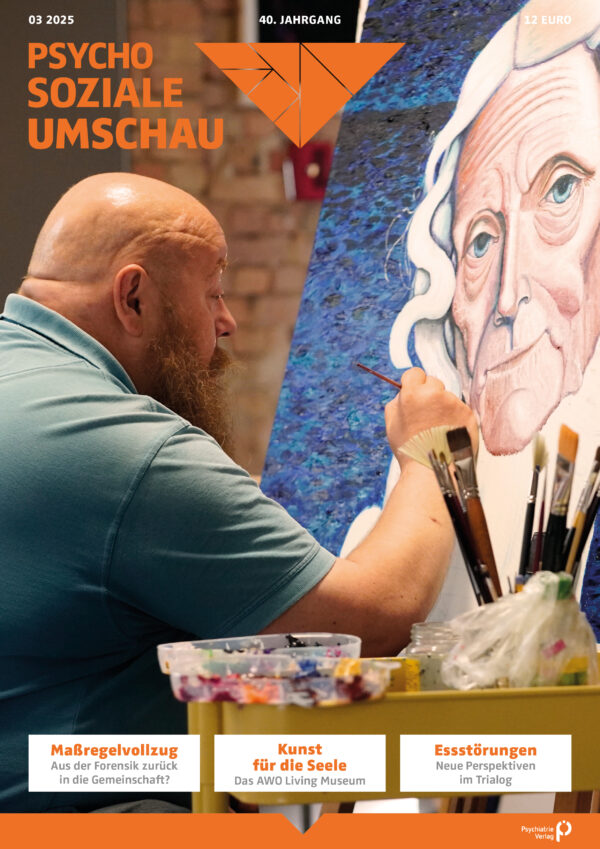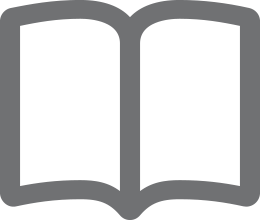Der Ablauf eines Strafverfahrens ist schon für manchen normalbegabten Beschuldigten nicht leicht zu verstehen.
Wie aber sieht es dann erst bei Menschen mit geistiger Behinderung aus?
Der Beitrag von Krüger, Schmitz und Niehaus spürt der Frage nach, inwieweit negative Einstellungen und behinderungsspezifische Mythen die Fallbeurteilung durch Verfahrensbeteiligte bei intellektuell beeinträchtigten Beschuldigten beeinflussen. In einer explorativen Studie zu Verfahren gegen Menschen mit geistiger Behinderung, die wegen Sexualdelikten angeklagt werden, gehen die Autoren dieser Frage auf den Grund.
Erkenntnisse der Unterarbeitsgruppe »Gefährlichkeit« der vom Bundesminister für Justiz der Republik Österreich eingesetzten Arbeitsgruppe »Maßnahmenvollzug« sind in den Artikel von Eher, Lindemann, Birklbauer und Müller eingeflossen. Kritisiert wird hier vor allem, dass in vielen Fällen die Kausalität zwischen psychischer Erkrankung und Anlasstat ebenso schwer festzumachen ist wie deren Einfluss auf schwerwiegende Folgetaten.
Sind kriminalprognostische Verfahren auf Frauen anwendbar? Das ist die Frage, der die Autoren Krammer, Mokros und Klecha für den deutschsprachigen Raum nachgehen. Ergebnis ist eine grundsätzlich vorhandene Kriteriumsvalidität der untersuchten Verfahren in Bezug auf erneute Straftaten, wobei sich eine Verallgemeinerung der Studienergebnisse allerdings als kaum möglich erwies. Eisenberg beschäftigt sich in einem Besprechungsaufsatz mit einem Verwerfungsbeschluss des BGH (Az. 4 StR 309/15) und der zugrunde liegen Entscheidung des LG Bielefeld, in denen es um den Vorwurf eines mängelbehafteten psychiatrischen Gutachtens geht.