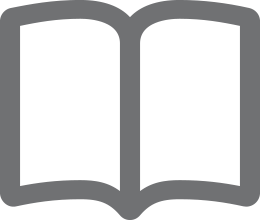Wenn Depressionen die Zeit nach der Geburt bestimmen
Postpartale Depressionen sind bis heute ein Tabuthema. Dabei erkranken allein in Deutschland etwa hunderttausend Frauen jährlich nach der Geburt an dieser ernst zu nehmenden Krankheit. Doch anstatt sich Hilfe zu suchen, verstecken die Betroffenen häufig ihre Symptome. Leiden heimlich. Fatal, denn je früher die Wochenbettdepression erkannt und behandelt wird, desto besser sind die Heilungschancen.
»Alles begann in der ersten Nacht nach Vanessas Geburt. Das kleine Wunder, das nur wenige Stunden zuvor unter Schreien aus meinem Bauch gepresst worden war, lag hilflos in seinem Bettchen. Zwei Hände voll Leben. Verantwortung bis in den Tod. War sie das süßeste Baby von allen? Mütter sagten das angeblich von ihren Kindern. Aber ich war mir da nicht so sicher. Meine Muskeln krampften von den Strapazen und die Endorphine ließen mich nicht schlafen. Vanessa atmete. Sie röchelte. Sie drehte sich um. Sie schmatzte. Und mir liefen Tränen über das Gesicht.«
So erzählt Carlotta Frey in ihrem Buch »Mutterglück« ungeschönt von ihrer inneren Zerrissenheit in den ersten gemeinsamen Stunden mit ihrem Baby. Sie ist ein typisches Beispiel für Mütter, die im Zuge von Schwangerschaft und Geburt an Postpartalen Depressionen erkranken. Ein Thema, das in Deutschland bis heute ein Tabu ist.
Baby Blues versus Wochenbettdepression
Dass es nach der Geburt häufig zum Baby Blues kommt, ist den meisten Müttern bekannt. Darüber wird häufig in Geburtsvorbereitungskursen gesprochen. Der Baby Blues wird vor allem durch die Hormonumstellung hervorgerufen und geht mit Traurigkeit und häufigem Weinen einher. Gegen dieses postpartale Stimmungstief ist die Postpartale Depression oder Wochenbettdepression abzugrenzen. Diese ernst zu nehmende, psychische Erkrankung kann schon bereits während der Schwangerschaft oder auch erst innerhalb des ersten Jahres nach der Entbindung einsetzen; am häufigsten tritt sie bei den Betroffenen aber in den ersten Wochen nach Geburt auf.
»›Die ersten Stunden ist das normal‹, sagten die Pflegerinnen. ›Die ersten Tage ist das normal‹, sagten die Ärzte. ›Die ersten Wochen ist das normal‹, sagten die Hebammen. Doch dann wurden es Monate und die Scham immer größer«, berichtet Frey. So wie sie müssen in Deutschland jährlich etwa hunderttausend Frauen eine Wochenbettdepression durchleben. Das entspricht zwischen zehn und fünfzehn Prozent aller Mütter. Aber auch die Väter sind davor nicht gefeit. Bis zu zehn Prozent von ihnen entwickeln eine Postpartale Depression – teils infolge der psychischen Erkrankung ihrer Partnerin, teils unabhängig davon.
»Da diese Erkrankung aber ein Tabuthema ist, empfinden die Mütter die Symptome als persönliches Versagen, glauben, die einzigen Mütter zu sein, die mit der neuen Rolle nicht zurechtkommen, und versuchen daher, so lange wie möglich dem in den Medien verbreiteten Bild der glücklichen und strahlenden Mutter zu entsprechen«, weiß Sabine Surholt, erste Vorsitzende der Selbsthilfeorganisation Schatten & Licht e. V. »Deshalb spricht man im englischen Sprachgebrauch auch von der Smiling Depression.« Das Problem: Anstatt frühzeitig Hilfe zu bekommen, wird durch diesen Umstand noch wertvolle Zeit verloren. Die Heilung wird hinausgezögert, der Leidensweg verlängert.
| Begriffsklärung |
Postpartale Depression: lateinisch: post = nach, partus = Niederkunft, Entbindung -> Dies ist eine korrekte und sehr häufig genutzte Bezeichnung für dieses Krankheitsbild. Ebenso kann auch der Begriff Wochenbettdepression verwendet werden. Postnatale Depression: lateinisch: post = nach, natus = Geburt -> Postnatale Depression wird ebenfalls häufig als Synonym verwendet. Tatsächlich bezieht sich dieser Begriff aber auf den Zustand des Kindes. Peripartale Depression: lateinisch: peri = um, partus = Niederkunft, Entbindung -> Dieser Begriff legt den Fokus auf die Zeit vor der Geburt. In der Praxis ist er deshalb nicht so häufig anzutreffen. |
Postpartale Depression: Symptome gibt es viele
Auch Carlotta Frey versuchte zunächst, ihre Depression zu verbergen: »Ich zog es vor, die Wahrheit der anderen Mütter zu leben. Ging unter Schweiß mit dem Kinderwagen spazieren, tröstete das weinende Bündel mit zittrigen Armen und lächelte meinen Mann zum Abschied mit flachem Atem an.« Doch mit Beginn der zweiten Schwangerschaft waren die Symptome nicht mehr zu verstecken. »Die Spülmaschine ausräumen? Einkaufen gehen? Das Bett neu beziehen? Allein das Wissen um die Notwendigkeit machte diese Dinge für mich unmöglich«, erklärt Frey in ihrem Erfahrungsbericht.
Tatsächlich sind die Symptome von Wochenbettdepressionen breit gefächert, vielleicht ein Grund dafür, warum diese Erkrankung so schwer zu fassen ist. Erkrankte Mütter berichten von seelischen Beschwerden wie Freudlosigkeit über körperliche wie Erschöpfung oder Konzentrationsstörungen hin zu psychosomatischen Anzeichen, beispielsweise Angst oder zwiespältige Gefühle dem Kind gegenüber. Weitere Symptome sind u.a.:
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Konzentrationsstörungen
- Schlafstörungen
- Erschöpfung
- Antriebslosigkeit
- Traurigkeit
- Freudlosigkeit
- Hoffnungslosigkeit
- Gefühl von innerer Leere
- Gefühl von geringem Wert
- Schuldgefühle
- Zwiespältige Gefühle dem Kind gegenüber
- Grübeln
- Panikattacken
- Ängste
- Zittern
- Herzbeschwerden
- Appetitlosigkeit oder verstärkter Hunger
- Hohe Reizbarkeit
- Stimmungsschwankungen
- Aggressionen und Wutausbrüche
- Sozialer Rückzug
- Sexuelle Unlust
- Suizidgedanken
Hinzu kommt, dass Depressionen häufig schleichend beginnen und viele frischgebackene Mütter unter mangelndem Schlaf, chronischer Müdigkeit und Konzentrationsproblemen leiden. Wer vermutet, nach der Geburt nicht am Baby Blues, sondern an einer Wochenbettdepression erkrankt zu sein, dem kann der Selbsteinschätzungstest EPDS (Edinburgh-Postnatal-Depressions-Skala) einen ersten Anhaltspunkt bieten. Er ist u.a. auf der Website der bundesweiten Selbsthilfeorganisation »Schatten & Licht e. V.« zu finden. Einen Gang in die Praxis, kann dieser aber nicht ersetzen.
Depressionen nach der Geburt: Warum ich?
So unterschiedlich die Symptome einer Postpartalen Depression ausfallen, so verschieden sind auch die Ursachen, die diese Erkrankung auslösen. In der Regel gibt es nicht den einen Grund, der für das Auftreten der Depression entscheidend ist. Meist spielen dabei eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle.
An körperlichen Ursachen sind der Schlafmangel, die körperlichen Veränderungen, die mit Schwangerschaft und Geburt einhergehen, sowie ein möglicher Nährstoffmangel zu nennen. Auch die genetischen Veranlagungen können ein erhöhtes Risiko bergen. Ob und wieweit auch die hormonellen Veränderungen relevant für die Entstehung von Depressionen in und nach der Schwangerschaft sind, ist bis heute nicht abschließend geklärt.
Sicher ist aber, dass die psychischen Gründe nicht außer Acht zu lassen sind, schließlich wird das bisherige Leben mit der Geburt eines Kindes auf den Kopf gestellt – selbst wenn das Kind ein Wunschkind war. Mit Beginn des Wochenbetts wird die Frau plötzlich die meiste Zeit des Tages auf die Mutterrolle reduziert, das kann eine Identitätskrise auslösen. Ist das Baby ein Schrei-Baby, hat die Frau hohe Erwartungen an sich selbst, oder werden belastende Situationen aus der der Vergangenheit getriggert, steigt die Gefahr, an Wochenbettdepressionen zu erkranken.
Die Liste an weiteren Faktoren ist endlos und zu individuell wie ein*e jede*r von uns. Zu erwähnen sind noch Komplikationen, die während Schwangerschaft und Geburt auftreten, sowie Spannungen in der Partnerschaft oder mangelnde, soziale Unterstützung. Insbesondere wenn der Alltag zu Hause wieder beginnt, sind die Mütter häufig auf sich alleine gestellt. Schlechte Nächte, Hausarbeit, weiterhin bzw. wieder gut aussehen, beruflich nicht auf das Abstellgleis geraten und schließlich noch das Baby – die Möglichkeiten, sich auszuruhen und die eigenen Bedürfnisse zu stillen, sind häufig rar.
Depressionen sind behandelbar
Als Carlotta Frey in einer Klinik eingeliefert wird und endlich durchatmen kann, beschreibt sie ihre Gedanken in ihrem Erfahrungsbericht so: »So lag ich auf meiner Decke und träumte davon, Teilzeitmutter zu sein. Meine Koffer zu packen und in eine WG zu ziehen. Hatte ich damals die falsche Entscheidung getroffen? Mein eigenes Glück gegen das meiner Kinder getauscht? Und was wog schwerer? Meine Verantwortung für mich oder die für die anderen? Dazu die Befürchtung, dass Töchter trauriger Mütter zu traurigen Frauen heranwachsen würden. Wie ich es auch drehte, die Schuld würde am Ende auf meinen Schultern liegen.«
Damit es soweit nicht kommen muss, gibt es zahlreiche Anlaufstellen, an die sich Mütter frühzeitig wenden können. Dazu zählen im ersten Schritt Nachsorgehebammen, Gynäkolog*innen, Hausärzt*innen oder Psychotherapeut*innen, sowie im Falle von Schrei-Babys sogenannte Schreiambulanzen. Auch gibt es zahlreiche Schwangerschafts- und psychosoziale Beratungsstellen von bspw. der Diakonie, der Caritas oder dem Projekt Frühe Hilfen, wo Betroffene entlastende Gespräche führen und konkrete Hilfsmöglichkeiten vor Ort herausfinden können, beispielsweise den Anspruch auf eine Haushaltshilfe. Akute Fragen können auch bei der Wochenbettdepression-Hotline Rhein-Main (015 77/ 47 42 654) des Klinikums der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt geklärt werden. Und wer verlässliche Informationen im Web sucht, wird auf den Websites der Deutschen Depressionshilfe und des Vereins »Schatten & Licht« fündig. Letzterer führt auch eine deutschlandweite Liste mit Fachleuten und Psychotherapeut*innen, an die sich Betroffene wenden können.
Denn als zentrales Mittel zur Genesung hat sich bei Postpartalen Depressionen die Psychotherapie bewährt – sei es bspw. die Verhaltenstherapie, die systemische Therapie oder ein tiefenpsychologischer Ansatz. Für welche der verschiedenen Therapieformen und -verfahren man sich entscheidet, hängt von der jeweiligen Persönlichkeit und der individuellen Vorgeschichte ab. Frauen, die von mittelschweren Depressionen betroffen sind, können außerdem von der zusätzlichen Gabe von Antidepressiva profitieren. Bei Müttern, die an schweren Wochenbettdepressionen erkrankt sind, ist eine medikamentöse Behandlung auf jeden Fall angezeigt. Ärzt*innen werden diesen außerdem zu einer stationären Therapie raten, damit sie sich schnellstmöglich wieder stabilisieren können. Eine Entscheidung, die betroffenen Müttern oft schwerfällt und die den Familienalltag sehr belasten kann. So auch Carlotta Frey und ihre Familie:
»›Ich soll in die Psychosomatik‹, murmelte ich. Traute mich nicht, ihm in die Augen zu schauen.
›Und für wie lange?‹
›Zehn Wochen‹, flüsterte ich.
Dann rollten die ersten Perlen über meine Wangen. Ich schielte zu Vanessa. Sie sammelte Zapfen. Mia immer hinter ihr her. So gut sie eben konnte.
›Uns ist allen nicht geholfen, wenn du krank wieder nach Hause kommst‹, sagte Jonas mit belegter Stimme.
›Das mag ja sein. Aber die Eingewöhnung von Mia in die Krippe, der Wechsel von Vanessa in den Kindergarten. Und dann ist auch noch Weihnachten.‹
Ich war die Mutter. Ich hätte meine Kinder in den nächsten Lebensabschnitt begleiten sollen.«
Herausforderung Familienalltag
Im Fall von Carlotta Frey kümmerte sich während ihrer Abwesenheit überwiegend ihre eigene Mutter um den Familienalltag. Sie zog für die Zeit des Klinikaufenthalts bei der Familie ein, erledigte Einkäufe, brachte die Kinder in den Kindergarten und die Krippe und übernahm das Nachmittagsprogramm mit ihnen. Ein Segen, auf den nicht jede Familie zurückgreifen kann. Glücklicherweise haben aber alle Familien in solchen Momenten Anspruch auf eine Familienhilfe, die über die Krankenkasse unter bestimmten Voraussetzungen beantragt werden kann. Auch das Jugendamt kann in Einzelfällen weiterhelfen.
Zusammen mit den o.g. Beratungsstellen und den Sozialarbeiter*innen der jeweiligen Kliniken lassen sich in den allermeisten Fällen individuelle Lösungen für die Zeit der Abwesenheit der Mutter finden. Und dennoch: Egal ob sich die depressive Mutter nun in stationäre Behandlung begibt oder eine ambulante Therapie anstrebt, die Väter müssen in der Regel für die Zeit bis zur Genesung besonders viel stemmen. Deshalb sollten sie gut mit ihren Kräften haushalten und sensibel für das eigene Wohlbefinden sein. Denn sonst droht nach der Genesung der Mutter noch die Depression des Vaters. Um dies zu verhindern, kann es auch lohnend sein, sich mit anderen Angehörigen psychisch erkrankter Menschen auszutauschen. Eine umfassende Übersicht deutschlandweiter Selbsthilfegruppen bietet beispielsweise der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. (BApK) auf seiner Website, auch für andere psychische Erkrankungen.
Nach der Depression: Zurück in einen neuen Alltag
Wie lange es bis zur Genesung dauert, dafür gibt es keine Faustregel. Generell gilt aber: Je früher die Depression erkannt und professionell behandelt wird, desto schneller klingt sie wieder ab. Häufig handelt es sich dabei um einige Monate, in einzelnen Fällen kann sich die Gesundung aber auch länger hinziehen. Was bei vielen Frauen nach der Wochenbettdepression außerdem zunächst zurückbleibt, sind Unsicherheiten und Ängste. Das alte Selbstvertrauen erstarkt häufig erst wieder mit der Zeit.
Auch Carlotta Frey schafft es nur langsam, sich nach der Postpartalen Depression zurück in den Alltag zu kämpfen:
»Von mir selbst überrascht stieg ich auf der Fahrerseite meines Kleinwagens ein. Iris und Jonas schnallten die Kinder an, dann ging es los. Motor starten, Kinderlieder ausschalten. Gas geben und Kupplung langsam kommen lassen. Ich rollte den Hang hinab zum Haupthaus, dann über den schmalen Weg durch den Wald auf die Landstraße.
›Kannst du noch?‹, fragte mich Iris, bevor wir auf die Autobahn abbogen
›Bis zum nächsten Rastplatz‹, nickte ich und beschleunigte auf hundert Kilometer pro Stunde. Richtgeschwindigkeit einhundertdreißig schaffte ich nicht. Wie eine Oma auf Sonntagsfahrt. Oder Oldtimer beim Schönwetterausflug. Doch darum ging es heute nicht. Ich saß hinter dem Steuer und das war das Einzige, was zählte.«
Die Angst, dass es wieder soweit kommen könnte, beschäftigt Mütter umso mehr, wenn sie sich noch ein Kind wünschen. Tatsächlich spricht in vielen Fällen nichts gegen eine erneute Schwangerschaft. Doch eine Pauschalantwort gibt es nicht. Hier gilt stets die Einzelfallentscheidung. Ob die Familienplanung nun abgeschlossen ist oder nicht, betroffene Frauen sollten auch nach der Überwindung der Wochenbettdepression sensibel für sich selbst sein. Im besten Fall haben sie das in der Psychotherapie mit professioneller Hilfe gelernt und wissen, auf welche Signale und Symptome sie achten müssen und welche Maßnahmen sie dabei unterstützt haben, in einen gesunden Alltag zu finden. So resümiert auch Carlotta Frey in ihrem Buch:
»Statt meiner Ideale lebe ich heute meine Träume. Kleine Träume, die erreichbar sind. Von einer Mietwohnung am Stadtrand, aus der ich jederzeit wieder ausziehen kann. Von einem Picknick, das ich bei Regen ins Wohnzimmer verlege, und von einem weiteren Urlaub, den ich allein mit meinem Mann verbringe. Doch das Wichtigste: Ich erlaube mir, eine durchschnittliche Mutter zu sein. Nicht alles richtig machen zu müssen. Mir viele Auszeiten zu nehmen und mir Hilfe zu holen. Denn ich will für meine Kinder da sein. So wie ich es eben kann.«

Mutterglück
Wie ich trotz postpartaler Depression zurück zu meinen Kindern fandInnere Leere, tiefgehende depressive Verstimmungen und überwältigende Schuldgefühle prägen Carlottas Gefühlsleben nach der Geburt ihrer Kinder und belasten die ganze Familie. Erst nach dem Zusammenbruch sucht sie Hilfe und kann diese annehmen. Der Erfahrungsbericht macht Frauen mit einer postpartalen Depression Mut und zeigt Wege aus der Überforderung.
Bild oben von Alexander Kivrakidis auf photocase.de